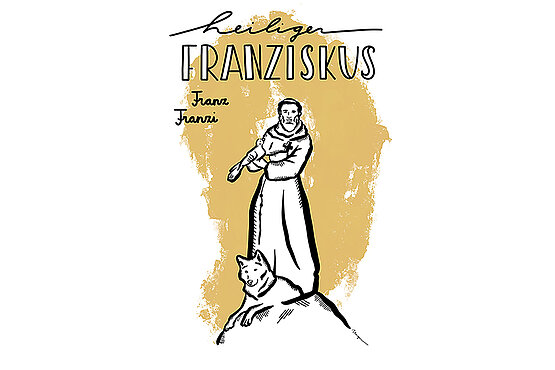Kirche und Einheit: Der Eklat von 1054
Keine Trennung, sondern Entfremdung
Nach dem Eklat von 1054 – auf dem Weg zur Wiedergewinnung der Einheit der Kirche in Ost und West“, so lautete der Titel des Festvortrags von Kardinal Kurt Koch, Präsident des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, am 16. Jänner in Wien.
Entscheidender Meilenstein für die Einheit der Kirche
„Nach einer langen Zeit der Trennung in der Kirche zwischen Ost und West haben auf dem ebenso langen Weg auf das Wiederfinden der verlorenen Einheit hin die Ereignisse vom 7. Dezember 1965 einen entscheidenden Meilenstein gebildet“, betonte Koch.
Gemeinsame Erklärung von Rom und Konstantinopel
Am Tag vor der Schlusssitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils haben Papst Paul VI. und der Ökumenische Patriarch Athenagoras von Konstantinopel zur gleichen Zeit in der Basilika Sankt Peter in Rom und in der Kathedrale Sankt Georg im Phanar in Konstantinopel eine „Gemeinsame Erklärung“ vortragen lassen. Darin hieß es: Die Exkommunikationssentenzen, die auf die traurigen Ereignisse dieser Epoche gefolgt sind und deren Erinnerung einer Annäherung in der Liebe bis heute hindernd im Wege stehen, werden bedauert, aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche getilgt und dem Vergessen anheimgegeben.
Historischer Auftrag der Delegation von 1054
„Es ist zunächst festzuhalten, dass die Delegation aus Rom, die im Jahre 1054 nach Konstantinopel gekommen ist, nicht geschickt worden ist, um einen Bann zu überbringen“, betonte Koch: „Sie hatte im Gegenteil den Auftrag der Friedensvermittlung im Blick auf die aufgrund des Einmarsches der Normannen in Süditalien entstandenen Probleme zwischen der lateinischen und der griechischen Kirche, da die dortigen Bistümer mit griechischsprachigen Gläubigen zum Patriarchat von Konstantinopel gehörten, von den Normannen aber lateinische Kirchenführer über das Volk mit griechischen Kirchenbräuchen eingesetzt worden waren. Wiewohl die Bedrohung durch die Normannen sowohl in Konstantinopel als auch in Rom verspürt worden ist, führten die Verhandlungen nicht zum Kirchenfrieden, sondern haben mit einem Eklat geendet.“
„... Persönlichkeiten, bekannt für ihre Unnachgiebigkeit ...“
Unnachgiebige Persönlichkeiten
Auf beiden Seiten waren Persönlichkeiten beteiligt, die für ihre Unnachgiebigkeit bekannt gewesen sind. „In Konstantinopel war Patriarch Michael Kerullarios im Amt, der politisch sehr ambitioniert gewesen ist und vor allem befürchtet hat, dass ein Zusammengehen von Papst und Kaiser auf Kosten der Unabhängigkeit des Patriarchats gehen würde“, erklärte Koch: „Auf der anderen Seite wurde die Delegation aus Rom von Kardinal Humbert von Silva Candida angeführt, der als Berater des Papstes ein Mensch mit einem aufbrausenden Temperament gewesen ist.“
Der Eklat von 1054
So sei es „zum Eklat am 16. Juli 1054“ gekommen, als der Kardinal mit seinen Begleitern auf dem Altar der Hagia Sophia die Bannbulle gegen den, wie es in der Bulle heißt, Pseudo-Patriarchen Michael niedergelegt hat. Nur wenige Tage später, am 20. Juli 1054, hat Patriarch Michael den Gegenbann gegen die Urheber der Exkommunikationsbulle ausgesprochen. Koch: „Die Exkommunikationsbullen richteten sich nicht gegen Kirchen, sondern allein gegen einzelne Persönlichkeiten: Die römischen Legaten haben den Patriarchen und einige seiner Mitarbeiter exkommuniziert, und einige Tage später hat der Patriarch die Legaten exkommuniziert."
Zunehmende Entfremdung
„Aus diesen historischen Beobachtungen kann nur der Schluss gezogen werden, dass es im Jahre 1054 keine Exkommunikation der lateinischen gegen die griechische Kirche und umgekehrt gegeben hat“, sagte Koch. Beim Jahr 1054 handle es sich „vielmehr um ein symbolisches Datum“. Von daher lege es sich nahe, „nicht von einem Schisma zu sprechen, sondern von einer zunehmenden Entfremdung in der Kirche zwischen Ost und West“. Da aber die Ereignisse von 1054 nicht die Trennung der Kirchen verursacht haben, konnte auch die „Gemeinsame Erklärung“ von 1965 nicht das Ende der Trennung bedeuten. Koch: „Ihr Verdienst besteht darin, dass die Exkommunikationsbullen von 1054 nicht mehr jenes Gewicht haben können, das sie über lange Zeit in der Geschichte ausgeübt und damit die Beziehungen zwischen Lateinern und Griechen vergiftet haben.“
Vier Fragen an Kardinal Kurt Koch
Herr Kardinal, das Ökumene-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils sagt: Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, sei eine der Hauptaufgaben des Konzils. Wie sieht gegenwärtig katholischerseits diese Suche nach der Einheit aus?
KURT KOCH: Das hängt sehr davon ab, mit welchen Kirchen wir im Dialog sind. Mit den Kirchen des Ostens sieht das anders aus als mit den Kirchen, die aus den Reformationen hervorgegangen sind. Ich denke, mit den Kirchen des Ostens haben wir ein ekklesiologisches Grundgefüge, also die Grundüberzeugung, was Kirche ist, weitgehend gemeinsam. Und so sollte es einfacher sein, die Einheit wiederzufinden.
Gibt es in der Ökumenischen Bewegung noch einen Konsens über das Ziel?
Mit den Kirchen des Ostens haben wir ein gemeinsames Ziel: die Einheit wiederzufinden im gemeinsamen Glauben, in den Sakramenten und in den kirchlichen Ämtern. Die Schwierigkeit, dass wir kein gemeinsames Ziel haben, ist eher mit den Kirchen, die aus den Reformationen hervorgegangen sind, weil da nicht wenige Kirchen die Vorstellung haben, Einheit heiße, alle die verschiedenen kirchlichen Realitäten als Kirchen zu erkennen und die Summe aller vorhandenen Kirchen sei dann die eine Kirche des Herrn. Das ist natürlich eine Vorstellung, die uns nicht so entspricht. Und von daher ist es wichtig, neu darüber nachzudenken, was das Ziel ist.
Manche sehen gegenwärtig eine gewisse Müdigkeit in der Ökumene, weil scheinbar wenig weitergeht. Was müssen wir Katholiken für die Ökumene tun?
Wir müssen uns einfach wieder neu bewusst werden, dass die Einheit nicht einfach eine Aufgabe ist, die wir auch noch haben, sondern dass sie der Wille des Herrn ist. Er spricht sie aus im Hohepriesterlichen Gebet im 17. Kapitel des Johannesevangeliums: Er betet, dass alle eins seien. Wenn es der Wille des Herrn ist, dann gibt es dazu keine Alternative.
Sie haben das Gebet für die Einheit angesprochen. Müssen wir noch mehr für die Einheit beten?
Das Wichtigste, das wir tun können, ist das Gebet für die Einheit. Die ganze Ökumenische Bewegung hat begonnen mit der Einführung der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Die Ökumenische Bewegung ist immer eine Gebetsbewegung gewesen. Wenn wir für die Einheit beten, dann bringen wir zum Ausdruck, dass wir Menschen die Einheit nicht schaffen können. Die Einheit ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und die beste Vorbereitung dafür, dieses Geschenk zu empfangen, ist das Gebet.
Zur Person: Kardinal Kurt Koch ist Präsident des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen – der Ökumene-Minister des Vatikan.