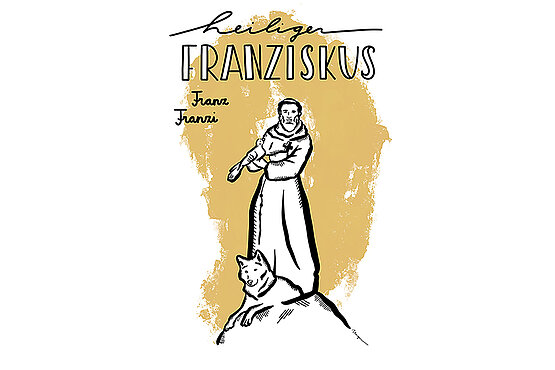Taylor Swift und der Glaube
Workshop: „Take us to church, Taylor!“
Mit dem Phänomen Swift beschäftigten sich Linda Kreuzer, Eva Puschautz, Annika Schmitz und Noreen van Elk an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien in einem Workshop.
Sie haben den Workshop „Take us to Church, Taylor! – Popkultur und Theologie am Beispiel von Taylor Swift“ von 9. bis 10. Jänner 2025 durchgeführt. Würden Sie sich selbst als „Swifties“ bezeichnen?
Eva Puschautz: Ich würde mich als neuen „Swiftie“ bezeichnen.
Noreen van Elk: Ich nicht. Ich habe mich dezidiert mit ihr bisher nicht auseinandergesetzt. Dass es auf einmal so ein Thema wurde, hat mich fasziniert.
Linda Kreuzer: Durch den Workshop und durch die tiefere Beschäftigung finde ich immer mehr Verbindung. Mir hat die Musik zuvor schon gefallen und ich wäre auch auf das Konzert in Wien gegangen, aber dass es zum Identifikationsfaktor wird, das entsteht bei mir gerade erst.
Annika Schmitz: Ich würde mal sagen, ich bin wahrscheinlich hier der große „Swiftie“ im Raum und das auch schon seit vielen Jahren. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, dass meine wissenschaftliche Beschäftigung damit noch mal auf einer anderen Ebene stattfindet als das persönliche Fan-Sein, auch wenn sich das natürlich gegenseitig befruchtet. Das ist das Schöne, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, die einem Spaß machen.
Was ist Ihr Fazit zu Ihrem Workshop?
Eva Puschautz: Inhaltlich würde ich sagen, dass wir uns mit vielen wichtigen Punkten auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel wie und ob sich „Megastars“ wie Taylor Swift politisch positionieren müssen. Eine wichtige Erkenntnis, die wir durch den Workshop gewonnen haben, war, dass der Begriff „Popkultur“ besser definiert gehört. Der Begriff wird für vieles verwendet, aber oft ist nicht klar, wovon eigentlich gesprochen wird. Popkultur wird oft belächelt, obwohl sie für viele Menschen wichtig ist. Das ist schade und ungerecht, denn die Menschen verdienen Anerkennung. Daher sollte man das ernst nehmen.
Linda Kreuzer: Besonders erfreut oder überrascht war ich, wie gut das aus einer fachübergreifenden Perspektive funktioniert hat. Jede Person konnte etwas dazu beitragen und anschließend hat man gemeinsam in der Gruppe darüber gesprochen. Diese bereichsübergreifende Vorgehensweise wird uns, glaube ich, auch in der Theologie zukünftig immer stärker begleiten.
Annika Schmitz: Ich habe mich über die vielfältigen und kritischen Vorschläge für Vorträge bei der Konzeption gefreut. Es ging nicht darum, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, Freundschaftsarmbänder knüpfen und uns in den Armen liegen. Es ging bei dem Workshop um eine wissenschaftliche Reflexion. Darunter waren Vorträge mit feministischen, politischen und theologischen Schwerpunkten.
Taylor Swift bezeichnete sich 2018 als „Christin“, unterstützt aber Frauenrechte (Thema Abtreibung) und LGBTQI+ Rechte, was von den Moralvorstellungen der amerikanischen Bischofskonferenz abweicht. Wie passt das zusammen?
Linda Kreuzer: Innerhalb des christlichen Spektrums können sich unterschiedlichste Positionen vereinen. Aus liberaler christlicher Perspektive gibt es sehr wohl ein klares Ja zu einer Solidarität mit LGBTQI+-Personen. In Bezug auf die reproduktiven Rechte von Frauen – das ist natürlich ein kritisches Thema – hat sie sich, zumindest in meiner Erinnerung, nicht dezidiert „pro-life“ geäußert, sondern sie hat sich generell für die Rechte von Frauen ausgesprochen. Meiner Einschätzung nach ist sie sehr vorsichtig. Sie ist keine, die aktiv bestimmte Themen von sich aus feministisch vorantreiben würde. Sie ist sehr zurückhaltend und eher auf Nächstenliebe, Unterstützung und Offenheit fokussiert, aber nicht konkret in Bezug auf politische Forderungen in der Öffentlichkeit aktiv.
Annika Schmitz: Es gibt bestimmt Künstlerinnen, die deutlich feministischer unterwegs sind, wenn ich mir zum Beispiel Billie Eilish, eine US-amerikanische Sängerin, anschaue. Bei Taylor Swift ist es auch eine interessante Entwicklung, wie sie sich von einem jungen Mädchen, das sich politisch gar nicht geäußert hat, zu einer Frau entwickelt hat, die dann öffentlich gegen Marsha Blackburn aufgestanden ist und sich aktiv in die Wahlkämpfe eingemischt hat. Swift hat sich selbst einmal als Christin bezeichnet, es gibt aber durchaus viele Christinnen und Christen, die sie aufgrund ihrer liberalen Positionen ablehnen. Aber wer hat die Deutungshoheit darüber, was etwa christliche Werte sind? Wir sollten dabei im Blick behalten, dass das Christentum in den USA noch einmal gespaltener ist als in Europa. Selbst in Deutschland und Österreich gibt es große Unterschiede in Bezug auf die kirchliche Realität. Ein Problem ist ein gewisses evangelikales Christentum, aber durchaus auch einige katholische Bischöfe, die mit einer solchen Vehemenz auf ihren eigenen Wahrheitsanspruch pochen, dass es wirklich ausschließend und diskriminierend gegenüber anderen wird. Aus evangelikalen Kreisen kommen Behauptungen, Swift würde Rituale von Hexen präsentieren, und das hat zu einer aufgeladenen Stimmung geführt. Diese Unterstellungen, die Swift in die Nähe des Satanischen rücken, sollte man sich genau anschauen, dann wird man feststellen, dass an solchen Vorwürfen nicht allzu viel dran ist.
Sie meinen die Vorwürfe zu dem Musikvideo zum Song „willow“, in dem Menschen in Umhängen mit leuchtenden Kugeln um ein Feuer tanzen, richtig?
Annika Schmitz: Ja, genau. Auf der „Eras Tour“, ihrer letzten großen Tournee, hat sie diesen Tanz auch aufgeführt, was einen Großteil der Kritik auf sich gezogen hat.
Noreen van Elk: Wir haben gemerkt, dass es sehr schwer zu definieren oder zu deuten ist, woher die religiösen Bezüge in Swifts Musik kommen und was sie damit bezwecken möchte. Geht es ihr dabei um eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte oder ist es eine Art von Aufforderung an ihre Zuhörerschaft, sich kritisch mit der Religion auseinanderzusetzen? Geht es vielleicht nur um Vermarktung oder will sie mit dieser Strategie mehr Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen? Versucht sie damit ein bestimmtes Publikum anzusprechen? In dem Workshop sind wir zu dem Schluss gekommen, dass man die Motivation dahinter nicht eindeutig festlegen kann und dass wahrscheinlich verschiedene Motive mit hineinspielen.
Eva Puschautz: Im Workshop kam auch immer wieder zur Sprache, dass so viele Menschen, vor allem Frauen, diese Konzerte als Safer Spaces empfunden haben. Als einen Ort, wo man sein kann, wie man ist. Und als einen Ort, wo man angenommen wird, so wie man ist, ohne Vorurteile. Diese Beobachtung kam mehrfach auf. Ist das nicht eigentlich das, was die Kirche sein will? Ein Ort, an dem Menschen so sein können, wie sie sind? Wir haben jedoch auch reflektiert, dass die Kirche dies nicht immer erreicht. Oft wird sie als ein Raum empfunden, in dem man sich nicht frei entfalten kann oder wegen seiner Art ausgeschlossen wird. Da war ganz oft die Frage: Kann man sich da vielleicht ein Vorbild nehmen? Will man sich daran ein Vorbild nehmen? Womöglich haben diese Konzerte genau das erreicht.
Ein Punkt Ihres Workshops war der Vergleich des Phänomens der „Swifties“ mit religiösen Gemeinschaften. Wo gibt es Parallelen? Wo gibt es Unterschiede?
Linda Kreuzer: In erster Linie muss man sich fragen: Wie definiere ich Religion überhaupt? Die Vortragende, Sarah Scotti, hat das sehr präzise ausgeführt, dass wir natürlich in engem Sinne nicht davon sprechen können, dass das „Swiftie“-Fandom eine eigene Religion ist. Es gibt Parallelen wie Ritualhandlungen, Gemeinschaftsgefühl, regelmäßige Versammlungen, die Verbindung zur Gemeinschaft und Symbole, die man trägt. Die Conclusio des Workshops war, dass wir nicht von einer eigenen Religion oder einem „Swiftianismus“ sprechen können. Es gibt Elemente, bei denen es interessant wäre, sie sich näher anzusehen. Wie zum Beispiel Liebe. Die ist in jeder Religion ein zentrales Motiv und auch in Taylor Swifts Werk. Ob das jetzt eine transzendente Liebe ist oder als eine solche gemeint ist, darüber haben wir diskutiert und das war ein spannender Teil der Textanalyse.
Annika Schmitz: Für mich persönlich ist interessant, wie leicht sich dieses Gefühl von Ergriffenheit religiös deuten lässt, gerade in Bezug auf die Musik. Ein gutes Beispiel ist die Musik manch evangelikaler Gemeinden, die viele Menschen mit einer Gotteserfahrung gleichsetzen. Auch die Fans von Taylor Swift erfahren mitunter ein Gemeinschaftsgefühl und Ergriffenheit. Für beide Formen gilt: Kann man eins von beiden wirklich als Gotteserfahrung bezeichnen – oder versucht man damit nicht viel mehr ein bestimmtes Gefühl auszudeuten, das Musik in uns auslöst?
Linda Kreuzer: Wir haben uns mit dieser Relation von Taylor Swift, dem Popstar, ihrem Werk und der Beziehung zu den Fans beschäftigt. Was sie so außergewöhnlich macht, ist ihre Fankultur. Viele Popstars begeistern Fans, aber bei ihr ist das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Die Art und Weise, wie Fans bei ihren Konzerten auftreten, ist besonders. Sie selbst beabsichtigt das nicht in dieser Form. Sie bietet den Fans einen Raum, um gemeinsam zu singen, die Lieder zu genießen und sich zu umarmen. Ob ich das als göttlich deute, hängt von der Person ab. Es gibt vielleicht Fans, die eine Gotteserfahrung während eines Taylor-Swift-Konzerts haben. Das würden wir jetzt nicht verneinen, das betrifft die subjektive Erfahrungsebene. Wir können viele Theorien aufstellen, aber wir haben kaum verlässliche Daten, wie Interviews mit Fans darüber, was Taylor Swift in ihnen auslöst.
Bietet das „Swiftie“-Fandom etwas, was die Religion und die Kirche den jungen Menschen nicht mehr geben können?
Noreen van Elk: Der zentrale Punkt ist ein Gefühl der bedingungslosen Zugehörigkeit und die Niedrigschwelligkeit der Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Man denke daran, welche Hürden es gefühlt gibt um Teil einer Kirchengemeinde zu werden: Die sind in der Wahrnehmung von jungen Menschen enorm. Erstmal muss man getauft sein, man muss auch die Liturgie kennen und dann gibt es da noch dieses Gefühl, dass die Kirche die Lebensrealität der Menschen nicht wirklich anerkennt. Es gibt auch Hürden in Bezug auf die „Swiftie“-Fangemeinde – da geht es um finanzielle Ressourcen. Das ist in der gefühlten Wahrnehmung der jungen Menschen jedoch viel weniger erheblich. Es ermöglicht für junge Menschen viel schneller das Gefühl der Zugehörigkeit als die Mitgliedschaft in eine Kirchengemeinde.
Eva Puschautz: Ein weiterer Aspekt ist, dass sie mit ihren Texten Menschen erreicht, dass sie damit in die Lebensrealitäten von Menschen hineingeht und wir uns im Großen und Ganzen kirchlich schwertun, da anzuknüpfen. Unsere kirchlichen und biblischen Texte sind massiv auslegungsbedürftig, weil sie aus einer anderen Zeit und einer anderen Kultur kommen. Gerade als Bibelwissenschaftlerin betone ich immer wieder, dass diese Texte nicht ohne ihren Kontext gelesen werden dürfen. Wir haben aber nicht immer die besten Rhetorikerinnen und Rhetoriker, die vorne am Ambo stehen und das dann gut erklären können. Was ich faszinierend finde, ist, dass Taylor Swift, die auch keine einfachen Texte schreibt, ihre Fans dazu bringt, mit Wörterbüchern vor dem Computer zu sitzen und Fremdwörter nachzuschlagen. Zum Beispiel singt Taylor Swift im Song „So Highschool“ davon, dass ihr Freund Football spielt und Aristoteles liest. Da werden dann ein paar Stimmen von Philosophinnen und Philosophen laut: „Die liest bestimmt nicht Aristoteles. Das versteht sie gar nicht.“ Dabei denke ich mir, dass sie lieber froh darüber sein sollten, dass sich dank des Liedes jetzt tausende Menschen hinsetzen und Aristoteles googeln. Sie ist besonders bei jungen Menschen und vor allem jungen Frauen so anschlussfähig, weil sie selbst eine Frau ist und aus ihrer Perspektive schreibt, in der sich junge Frauen wiedererkennen.
Annika Schmitz: Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man sich die Frage stellt: Was kann jetzt die katholische Kirche von Taylor Swift lernen? Ich finde, das ist die falsche Frage. Es gibt auch an vielen anderen Orten Fangemeinden und Formen von Vergemeinschaftung. Man könnte dann genauso gut fragen: Was machen Fußballclubs richtig, dass die Menschen da jeden Sonntag hingehen und nicht in die Kirche? Die Frage ist viel eher, was machen Institutionen und Vereine, um Menschen diese Erlebnisse von Vergemeinschaftung zu ermöglichen, und was macht die Kirche? Und gibt es nicht doch eine Form von Transzendenzerfahrung, die sich eher in kirchlichen Räumen findet?
Linda Kreuzer: Taylor Swift tritt selbst nie paternalistisch auf. Das ist schon ein sehr entscheidender Punkt. Wenn es in den Texten eine gewisse Selbstoffenbarung und Selbstreflexion gibt, dann bietet sie das als Angebot an, das ich annehmen kann oder nicht. Das ist etwas anders als in einer kirchlichen Gemeinschaft, wo ich bereits fertige Modelle „geliefert“ bekomme und darin unterwiesen werde. Auch finde ich dort meine eigene Position immer in einer Hierarchie wieder. Die Taylor-Swift-Fans haben – im Unterschied dazu – das Gefühl, mit ihrem Star auf Augenhöhe zu sein. Wenn ich ein Lied von Taylor Swift höre, kann ich das mit meiner eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen, fühle mich aber in keiner Weise unterrichtet oder belehrt. Es ist ein sehr subjektives, verbundenes und weniger hierarchisches Arbeiten, welches hier am Werk ist. Und das können Menschen gut annehmen. Das, was sie mit ihrem Werk liefert, funktioniert, und ich glaube, dass spricht Menschen an.
Die Fans von Taylor Swift hören nicht nur ihre Lieder, sie lesen und interpretieren gemeinsam die Songtexte. Sind die Liedtexte ähnlich wertvoll für „Swifties“ wie die Heilige Schrift für Christen?
Eva Puschautz: Nein, der Unterschied ist, dass die Kirche mit einem Heilsversprechen kommt. Die Texte von Taylor Swift haben etwas ganz Subjektives. Sie haben nicht den Anspruch, Heil zu bringen. Der Unterschied liegt auch darin, dass in den Texten von Swift Probleme abgebildet werden, die viele Menschen von heute erleben. Taylor Swift ist eine weiße Frau, früher aus der gehobenen Mittelschicht, jetzt eindeutig aus der Oberschicht. Sie bringt damit eine eigene Sammlung von Erfahrungen ein, die zwar aus einer sehr privilegierten Position kommen, mit denen sich jedoch immer noch viele Menschen identifizieren können. Biblische Texte können das in dieser Direktheit nicht, weil wir hier eine zeitliche Brücke dazwischen haben. Ich bin dennoch der Überzeugung, dass in den biblischen Texten etwas ganz Aktuelles steckt und darin Aussagen von Relevanz für unsere heutige Zeit enthalten sind. Der Weg, um sich diese zu erschließen, ist jedoch ein viel weiterer.
Annika Schmitz: Wir sprechen im Christentum vom Bibelkanon, also von einem Leitfaden von Texten, der normativ ist. Das ist etwas, was die Lieder von Swift nicht für sich in Anspruch nehmen. Sie wollen nicht der Leitfaden sein, auf dessen Grundlage der Mensch sein Leben aufbaut. Daher bin auch ich mit Vergleichen sehr vorsichtig. Sobald ich die Heilige Schrift als Offenbarung betrachte, bewegt sich das Ganze auf einem völlig anderen Niveau. Interessant ist die Frage nach beiden Orten als Erfahrungsräumen, die Erlebnisse von bestimmten Begegnungen widerspiegeln und in denen sich Menschen wiederfinden können. Was die Frage von Performanz oder Wirksamkeit angeht, glaube ich, dass wir das an beiden Orten finden – sowohl in der Heiligen Schrift als auch in Taylor Swifts Liedern. An beiden Orten können Menschen Wirklichkeiten schaffen, indem sie Texte lesen und auf ihr Leben anwenden. Nur wohnt den Texten von Swift kein Wahrheitsanspruch inne. Taylor Swift baut sich immer mehr ihr eigenes Referenzwerk auf, indem Lieder auf neueren Alben auf frühere Texte verweisen. Vieles versteht man erst, wenn man die alten Songs kennt und textlich sowie musikalisch Anknüpfungspunkte findet. Das ist in der Bibel übrigens ganz ähnlich.
Gibt es aus Ihrer Sicht ein Lied, das besonders starke religiöse Bezüge aufweist?
Eva Puschautz: Das Lied, das mir da gleich in den Sinn kommt, ist auf dem aktuellen Album „The Tortured Poets Department“. Schon im Titel findet man den ersten Bezug – das Lied heißt „Guilty as Sin“, also schuldig wie die Sünde. Sünde klingt in vielen Ohren wie eine religiöse, christliche Prägung. Sie singt über eine Beziehung, die nicht sein darf, weil entweder sie vergeben ist oder das Gegenüber vergeben ist. Es ist noch nichts passiert, aber man fühlt sich massiv schuldig, wegen all der Fantasien, die sich im Kopf aufgebaut haben. Man hat das Gefühl, man ist dieser Person schon nahe, durch alles, was da ist. Im Mittelteil des Liedes ist der spannende Satz „What if I roll the stone away? They gonna crucify me anyway“ („Was, wenn ich den Stein wegrollen würde, sie werden mich ja sowieso dafür kreuzigen“). Das sind natürlich zwei sehr christlich geprägte Bilder. Taylor Swift bricht solche christlichen Anspielungen immer. Sie kommen also nie so vor, wie man sich das jetzt gut katholisch erwarten würde. In diesem Text stellt sie sich in eine sehr mächtige Rolle hinein, wenn sie sagt, dass sie den Stein wegrollt. Das Spannende daran ist, dass sie die Reihenfolge umdreht. Wenn wir die Leidensgeschichte lesen, ist ganz klar: Zuerst kommt die Kreuzigung und dann kommt der Stein vom Grab weg. Swift dreht das Bild in ihrem Text um.
Annika Schmitz: Es ist tatsächlich so, dass man auf jedem ihrer Alben religiöse Bezüge findet. Zum Beispiel das Lied „False God“ vom Album „Lover“. Auch hier steckt der religiöse Bezug schon einmal im Titel. Im Lied geht es um eine Liebesbeziehung, die im Grunde mit einem Götzendienst parallel gesetzt wird. Dadurch ziehen sich die religiösen Motive auch durch den gesamten Song. Auch im Song „The Black Dog“ auf ihrem aktuellen Album sind religiöse Bezüge zu finden. In dem Lied geht es um das Pub, in das ihr Freund jetzt ohne sie hingeht. Plötzlich kommt da die Zeile: „And I want to call a priest to exorcise my demons.“ Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Das kommt öfter vor in ihren Liedern.
Eva Puschautz: Spannend war auch das Lied, in dem Taylor Swift über die Krankheit ihrer Mutter singt: „Soon you'll get better“, worüber wir dann länger diskutiert haben. Da lautet ein Vers sinngemäß: „Wenn Leute verzweifelt sind, fangen sie an zu beten oder wenden sich Jesus zu, dann probiere ich das jetzt auch.“ Wir haben darüber gesprochen, welches Bild von Religiosität das vermittelt. Mein Eindruck ist, dass solch ein Blick auf Religiosität sehr weit verbreitet ist, dass Religion dann zum Tragen kommt, wenn sonst nichts mehr hilft. Ich finde es schön, dass dieser weit verbreitete Ausdruck von Religiosität, auch unter Katholikinnen und Katholiken, in aktueller Musik vorkommt, weil er die Realität widerspiegelt. Da kann man als Katholik sagen: „Aber so kann man doch mit Religion nicht umgehen und man sollte doch jeden Tag in der Bibel lesen und jeden Sonntag in die Kirche gehen!“ Das entspricht nicht der Lebensrealität – auch nicht der Mehrheit der Katholiken.
Linda Kreuzer: Man kann deswegen davon ausgehen, dass Taylor Swifts kultureller Hintergrund klar christlich geprägt ist. Es gibt eine Form von christlicher Kulturhegemonie, und sie kann ihre Wurzeln nicht verleugnen. Das Schöne an Taylor Swift ist, dass wir ihr Erwachsenwerden miterlebt haben, die Fans haben sie erwachsen werden lassen. Sie kommt aus einer bestimmten musikalischen Richtung, die wiederum auch ihren Kontext hat: Die Country-Musik stammt aus einem Milieu, das christlich geprägt war. Es wäre spannend zu erfahren, wie diese Bilder auf Menschen mit nicht-christlichem Hintergrund wirken, denn das wissen wir leider nicht. Sie hat zwar weltweit Erfolg, auch in Ländern wie zum Beispiel Thailand, aber wie das genau funktioniert mit den christlichen Bildern, wäre spannend zu hinterfragen.
Ich habe gelesen, dass in Gottesdiensten vor allem das Lied „Anti-Hero“ von Taylor Swift gut ankommt. Warum?
Linda Kreuzer: Ich habe da bloß eine Vermutung. Ich kenne das von evangelischen Gottesdiensten, in denen darauf Bezug genommen wird. Das Lied hat einen befreienden, bestärkenden Charakter. Einerseits nicht dieses Romantisieren, sondern ich bin wie wir alle sterblich und habe meine Fehler. Mein Eindruck ist, dass es ein Ermutigen ist, so zu sein, wie man ist.
Eva Puschautz: In meiner Pfarre im Burgenland gibt es Jugendgottesdienste, die maßgeblich auf Firmlinge ausgerichtet sind. Das Bestreben, gerade für diese Altersgruppe ein Lied zu finden, das die Erfahrungen der Jugendlichen spiegelt, ist verständlich. Die Pubertät ist nicht immer eine lustige Zeit, denn es gibt Ausgrenzungserfahrungen und man hat das Gefühl, man gehöre nirgendwo dazu. Das drückt auch das Lied aus, in dem es heißt: „Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I'm the monster on the hill“ („Manchmal habe ich das Gefühl, alle sind so sexy und ich bin das Monster auf dem Hügel“). Ich finde, das ist eine klassische Teenager-Erfahrung, zu sagen, alle anderen sind so großartig und ich passe da überhaupt nicht hinein. Gerade Social Media bekräftigt solche Gefühle. Es sind pragmatische Ansätze, um mit Jugendlichen darüber zu sprechen, dass sie damit nicht allein sind. Sogar jemand, der so groß ist wie Taylor Swift, singt darüber. Ich denke, dass das für viele anschlussfähig ist, in einer Zeit, die von Perfektionismus geprägt ist.
Inwiefern können Taylor Swifts Lieder als Reflexion über moralische und ethische Fragen verstanden werden?
Annika Schmitz: Ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. In einigen Liedern macht Taylor Swift Aussagen über ihre eigenen Moralverständnisse. Zum Beispiel in „You need to calm down“ gibt es eine Textzeile, die lautet: „The shade never made anybody less gay“, also ein ganz klarer Aufruf für die Gleichberechtigung der queeren Community. Der Song „The Man“ kann durchaus eher feministisch gelesen werden. Es gibt Lieder, die Erlebnisse widerspiegeln und in denen sich Erfahrungsräume öffnen. Solche Räume sind auch immer mit ethischen Fragen verbunden. Es ist aber bestimmt nicht ihr erster Ansatz, über ihre Songs eine Moral verkaufen zu wollen.
Linda Kreuzer: Das ist das Erstaunliche, dass sie sich wirklich stark zurücknimmt. Sie äußert sich seit dem Jahr 2018 zwar immer stärker politisch oder moralisch, aber gleichzeitig auch mit dem Hinweis: Informiert euch selbst, bildet euch selbst eine Meinung. Sie macht nicht einen bloßen Aufruf für eine Kandidatin, sondern schickt den Appell voraus, zur Wahl zu gehen. Sie manipuliert nicht offensichtlich und macht keine Aufrufe im klassischen Sinn. Sie lässt Spielraum. Das spricht auch die Menge an. Sie hat ein großes Spektrum an Fans, nicht nur in politisch liberalen Gemeinden, sondern auch konservative Fans. Das ist möglich bei ihr, weil sie inklusiv sein möchte und sich dementsprechend darstellt. Konkrete politische Aufforderungen in Liedern, abgesehen von „You need to calm down“, wo sie sich auch konkret an Menschen wendet, sind mir in dem Sinne nicht bekannt.
Bilder vom Workshop "Take us to church, Taylor!"

Linda Kreuzer
arbeitet als Sozialethikerin an der Univiersität Wien.

Eva Puschautz
ist Neutestamentlerin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien. Außerdem leidenschaftliche Chorsängerin und Taylor Swift Fan.

Annika Schmitz
ist Theologin und Journalistin, seit Oktober 2023 ist sie Redakteurin der Herder Korrespondenz. Zuvor war sie Redakteurin bei der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Sie studierte katholische Theologie in Freiburg, Wien, im Theologischen Studienjahr Jerusalem und an der Yale University in den USA.

Noreen van Elk
ist Universitätsassistentin (Postdoc) am Institut für Systematische Theologie und Ethik, Fachbereich Sozialethik, an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.