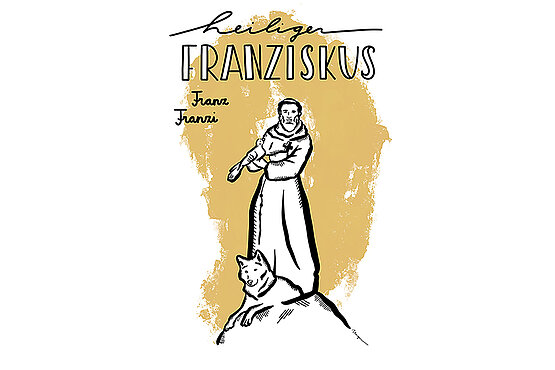Sie meinten es ernst mit der „Freiheit“
Bauernkrieg 1525
Wenn wir in die Zeit von 1525 schauen, dann sehen wir eine Welt im Umbruch, mit sehr viel Schatten, es fließt auch sehr viel Blut. Wie geht es einer Welt, die im Umbruch ist, die in Transformation ist: Wie gestaltet man einen Umbruch, ohne dass Blut fließt?“: Das ist für den evangelischen Altbischof Michael Bünker eine der Lehren aus dem Bauernkrieg, der vor genau 500 Jahren an die 100.000 Todesopfer forderte. Im Gespräch mit dem SONNTAG erläutert Bünker, er spricht am 7. Mai bei den „Theologischen Kursen“ in Wien, die Rolle des Thomas Müntzer, damals ein Gegenspieler von Martin Luther, und die Hintergründe, warum es zu diesem Bauernaufstand überhaupt gekommen ist.
Bauernkrieg: Beginn und Ursachen
Warum verließen im Frühjahr 1525 tausende Menschen, vor allem Männer, aber auch Frauen, ihre Dörfer, um gegen ihre damaligen „Herren“, meist der Adel und die Bewohner der reichen Klöster und Abteien, aufzubegehren? Immerhin war der Bauernkrieg der wohl größte Volksaufstand Europas vor der Französischen Revolution ...
MICHAEL BÜNKER: Es hat sich eingebürgert, dieses Ereignis als Bauernkrieg zu bezeichnen, der ein ganzes Bündel von Ursachen hat. So gab es eine Veränderung der Arbeitsbedingungen der bäuerlichen Bevölkerung: weg von der reinen Subsistenzwirtschaft, wo nur für den eigenen Verbrauch die benötigten Güter selbst produziert wurden, immer mehr hin zu einer Marktwirtschaft. Das, was die Bauern produzieren, das, was sie an Arbeitszeit zur Verfügung stellen können, auch die Transportleistungen, zu denen sie verpflichtet waren, und die Frondienste, das alles wird plötzlich eine marktförmige Ware. Es entsteht so etwas wie der Frühkapitalismus und man produziert plötzlich Flachs. Kein Bauer brauchte für den Eigenbedarf Flachs, aber für den Handel war er notwendig. Und diese Veränderungen sind so massiv, dass sich die Bauern regional zusammentun. Der Bauernaufstand ist ein regionales Ereignis, er beginnt im schweizerischen, südwestdeutschen Raum und setzt sich dann fort bis nach Thüringen, aber nicht bis in den Norden Deutschlands und auch nicht in andere Länder außer Österreich, etwa in Tirol und in Oberösterreich. Es beginnt diese Empörungsbewegung, die sich hauptsächlich gegen die Grundbesitzer richtet. Die „Zwölf Artikel“ von Memmingen vom März 1525 sind immer noch ein sehr eindrucksvolles Dokument.
„Die Menschen mussten um Erlaubnis fragen, wenn sie geheiratet haben.“
Michael Bünker
Welche Rolle spielte für die Bauern Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“?
Luther hat 1520 drei reformatorische Schriften verfasst – „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“, „An den christlichen Adel deutscher Nation“ und „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Diese Schrift ist begierig aufgenommen worden. Das Stichwort der „Freiheit“ war etwas, das für die bäuerliche Bevölkerung ganz besonders wichtig war. Und besonders für die, die unter schwierigen Verhältnissen leben mussten, als die Leibeigenschaft noch gegeben war. Leibeigenschaft hat ganz massive Auswirkungen gehabt auf die Lebensbedingungen. Die Menschen mussten ihre Grundherren um Erlaubnis fragen, wenn sie geheiratet haben. Es wurde nach ihrem Tod noch eine Art Sterbesteuer („Todfall“) von den Nachkommen eingehoben. Und sie wurden verpflichtet zu arbeiten. Dieser Zustand der Unfreiheit macht es sehr verständlich, dass plötzlich das Wort Freiheit ganz oben und auf den Fahnen steht. Diejenigen, die sich der Reformation nicht angeschlossen hatten, die Rom treu geblieben waren, haben auch sehr schnell den Verdacht geäußert, dass Luther an diesem Aufruhr schuld sei. Er habe mit seiner Schrift und überhaupt mit den Gedanken der Reformation die Türe geöffnet, sodass dieser Aufruhr möglich geworden ist. Und vielleicht hat Luther aus diesem Grund besonders heftig diesen Vorwurf von sich gewiesen und massiv einen anderen Schuldigen gesucht, nämlich den „Satan von Allstedt“, Thomas Müntzer.
Die „Zwölf Artikel“ von Memmingen
Die „Zwölf Artikel“ von Memmingen haben eine faszinierende Vision von der Beziehung des Menschen zur Schöpfung. Da geht es aber auch um praktische Dinge wie die Fischereirechte oder das Recht zu jagen ...
Der erste Artikel ist typisch reformatorisch: nämlich das Recht, den Pfarrer zu wählen und das Recht auf eine Predigt, die rein und lauter nur das Evangelium verkündigt. Aber dann kommen typische Punkte, die das bäuerliche Leben betreffen. Da stehen das Jagdrecht, das Weiderecht und das Fischereirecht natürlich ganz oben. Die Leibeigenschaft wird erneut in Frage gestellt, durchaus mit einem religiösen Hintergrund: Christus hat uns alle durch sein Blut erlöst in gleicher Weise. Und dieses Blut teilen wir sogar im Abendmahl. Nach evangelischem Verständnis haben wir auch den Kelch für alle. Und insofern sind diese Memminger Artikel nicht nur ein frühes Dokument von Grund- und Freiheitsrechten, vielleicht so etwas wie ein Vorläufer der späteren Menschenrechte, sondern auch ein Beispiel, wie man aus religiöser biblischer Überzeugung Folgerungen ziehen kann für das Zusammenleben der Menschen. Und insofern sind sie schon revolutionär.
Was weiß man über Thomas Müntzer?
Gar nicht so viel. Die meiste Zeit in der Geschichte ist über Thomas Müntzer gar nicht viel gesagt worden. Man weiß nicht einmal genau, wann er geboren wurde, viele Stationen in seinem Leben sind unbekannt, es gibt einige Schriften von ihm. Abgesehen von der Verteufelung des Thomas Müntzer durch Martin Luther und Philipp Melanchthon: Unmittelbar nach dem Scheitern des Bauernkrieges im Frühjahr 1525 war Müntzer plötzlich der Bauernführer, der daran schuld war, was so pauschal aber nicht stimmt. Dann taucht Müntzer erst wieder auf im Zuge der marxistischen Deutung des Bauernkrieges, etwa bei Friedrich Engels Mitte des 19. Jahrhunderts. Er galt dann als ein Vorläufer der späteren Revolutionen und dann beginnt das neue Interesse an dieser Auflehnung. Die DDR verklärt ihn später gleichsam als den Anführer der sogenannten frühbürgerlichen Revolution. Sowohl die frühe Verteufelung durch Luther wie auch die Verklärung durch Engels und die DDR sind wahrscheinlich nicht zutreffend.
Bauernkrieg: Müntzer - Mystiker oder Revolutionär?
Manche sehen in Müntzer einen Mystiker, andere einen Revolutionär ...
Müntzer war stark von der deutschen Mystik beeinflusst. Er war der festen Überzeugung, dass der Umbruch im Inneren der Seele entscheidend ist. Und dass Gott zu uns nicht nur durch die Schrift und durch die Worte der Bibel spricht, sondern auch durch Träume, Prophezeiungen, Eingebungen im Inneren der Seele – also typisch mystisch. Er war auch ein Apokalyptiker. Das heißt, er erwartete das herannahende Weltende morgen und das lieber früher als später. Und er war letztlich auch ein Revolutionär. Weil ihm klar war, dass dieser innere Umbruch in der Seele des Menschen, dort, wo Gott den Menschen quasi neu macht, dass das nicht ohne Folgen sein kann für das politische und soziale Zusammenleben.
„Luthers Äußerungen zum Bauernkrieg gehören zu seinen Schattenseiten.“
Michael Bünker
Warum hörten also die Bauern den Predigten Thomas Müntzers zu, die anders waren als die des Reformators Martin Luther?
Luther und Müntzer haben Vieles gemeinsam. Das Wichtigste, was sie gemeinsam hatten: Sie hatten beide wenig Ahnung vom Leben der Bauern, denn beide stammten aus dem Bergbaumilieu. Und das war eine andere Welt als die der Bauern. Sie hatten auch noch weiters gemeinsam, dass sie ihre Forderungen mit der Bibel begründet haben. Luther forderte den Gehorsam unter der weltlichen Obrigkeit – mit biblischer Begründung. Müntzer befürwortete ein Widerstandsrecht gegen die Obrigkeit – mit biblischer Begründung. Das heißt, die biblischen Begründungen sind immer zu diskutieren und immer in Frage zu stellen. Dass Müntzer sich relativ spät den aufständischen Bauern angeschlossen hat, hängt mit seiner Biographie zusammen. Er meinte, dass das herannahende Weltende durch diese Empörung befördert würde. Er schließt sich dann eigentlich erst in Allstedt 1523, zwei Jahre vor seinem Tod, diesen Bewegungen an. Er besucht dann die „Haufen“ der Bauern, wie sie genannt wurden, in Nürnberg, in Schwaben und auch in der Schweiz. Als er dann in Mühlhausen ist, ruft er selber zur Beteiligung an diesem Aufstand auf, auch zur Gewalt, und schließt sich den Bauernhaufen in Frankenhausen an. Und er erlebt dort diese schreckliche Niederlage. Müntzer wird gefoltert und am 27. Mai 1525 vor den Toren der Stadt Mühlhausen hingerichtet.
Im März 1525 erreichte der Bauernkrieg seinen Höhepunkt, im Mai wendete sich das Blatt. Luther hatte sich auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen für die Fürsten und gegen, wie er schrieb, die Bauern als „die rasenden Hunde“ ausgesprochen. Hat Luther die Bauern sozusagen verraten?
Luthers Äußerungen zum Bauernkrieg, „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ aus dem April 1525, gehören sicher zu den Schattenseiten. Der große Reformator ist ja für uns kein Heiliger, er hat seine deutlichen Schattenseiten: Sein Teufelsglaube gehört dazu und auch der Antisemitismus. Aber auch dieser unmäßige Gewaltaufruf gegen die Bauern – mit der Legitimation, dass man einen aufständischen Menschen wie einen tollen Hund erschlagen sollte. Luther hat das nicht verstanden und nicht akzeptiert, dass die Freiheit, von der er spricht, die Freiheit eines Christenmenschen, dass die sich auch im weltlichen Leben, im alltäglichen Leben niederschlagen muss. Der Adel schlachtet diese Bauern dann ab, das ist ein gutes Stück weit auch Luther zuzuschreiben. Dies wäre auch ohne ihn geschehen, aber er hat es nicht nur nicht verhindert, sondern auch noch befördert.

Zur Person:
Michael Bünker ist Altbischof der evangelischen Kirche (Augsburger Bekenntnis) in Österreich.
Termintipp:
Altbischof Michael Bünker (Evangelische Kirche, Augsburger Bekenntnis) spricht am 7. Mai bei den „Theologischen Kursen“ von 16:00 bis 17:30 Uhr zum Thema „Thomas Müntzer – Mystiker und Revolutionär. Ein Beitrag zu 500 Jahre Bauernkrieg“.