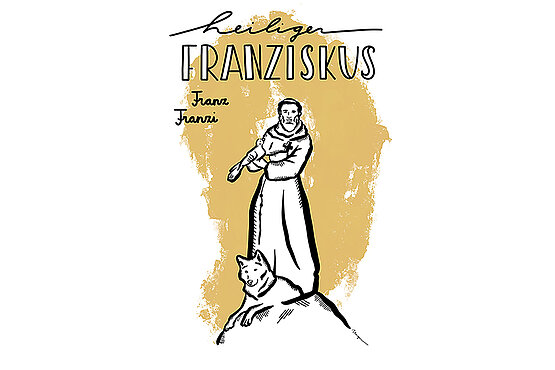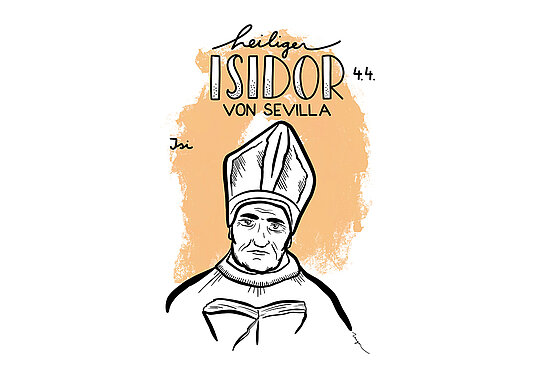Respekt statt Attacken
17. Jänner: Tag des Judentums
Graz hat nach Wien die zweitgrößte jüdische Gemeinde Österreichs. Das mutet ein bisschen seltsam an, wenn man dies so sagt, denn sie hat 250 bis 300 Mitglieder. Baden hingegen ist deutlich kleiner mit rund 80 bis 100 Mitgliedern“, sagt Elie Rosen im Gespräch mit dem SONNTAG. Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in der steirischen Landeshauptstadt Graz und Präsident der Jüdischen Gemeinde in Baden bei Wien, wurde am 8. Jänner auch zum Präsidenten der jüdischen Gemeinde Salzburgs gewählt.
Wie könne dann ein Gottesdienst am Schabbat gehalten werden, wenn man nach jüdischer Tradition zehn Männer dafür braucht? Ein solcher sogenannter Minjan umfasst zehn oder mehr im religiösen Sinn mündige Juden, damit ein vollständiger jüdischer Gottesdienst abgehalten werden kann. „Die Gottesdienste sind in Baden deutlich schwerer zu gestalten als etwa in Graz“, sagt Rosen: „Allerdings darf man in den Gemeinden nicht immer auf die Personenzahl allein abstellen, weil die Personenanzahl noch nichts über die Aktivität aussagt. Es gibt Gemeinden mit 600 Mitgliedern, die keine Gebete schaffen oder keine ausreichende Anzahl an Männern zusammenbekommen. Und es gibt Gemeinden, die haben nur 80 Mitglieder, und die schaffen das.“ Es sei dies allerdings in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden, „weil durch den Generationenwechsel die Gemeinden oder Synagogen immer mehr unterschiedliche Aufgaben dazubekommen haben“, betont Rosen.
Im August 2020 wurden Sie in Graz auf offener Straße attackiert. Wie haben Sie diesen tätlichen Angriff verkraftet?
Elie Rosen: Die Attacke selbst hat auf mein Engagement und auf meinen Alltag relativ wenig Einfluss genommen. Aber die Sicherheitsmaßnahmen wurden deutlich verstärkt. Die Sicherheit ist jetzt vordergründig, psychisch war der Angriff aber kein Thema.
Juden fürchten sich wieder auf den Straßen Europas. Was bedeutet dies für das Judentum, dass der Antisemitismus laut Studien wieder rasant zunimmt?
Für uns Juden bedeutet das sicherlich eine größere Achtsamkeit und eine deutlich stärkere Betroffenheit. Durch die historischen Fakten und durch die Erfahrungen, wie sie eben durch die Shoah, durch die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten, gegeben sind, vor allem in Zentraleuropa, sind wir natürlich besonders sensibilisiert. Ich würde das nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass der Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft deutlich unterschätzt und vielleicht auch zu wenig wahrgenommen wird und dementsprechend wird dem auch zu wenig entgegengetreten.
17. Jänner: Tag des Judentums
Am 17. Jänner begehen die Kirchen in Österreich seit mehr als 20 Jahren den „Tag des Judentums“ zum Gedenken an die jahrhundertelange Geschichte der Vorurteile und Feindseligkeiten zwischen Christen und Juden und zur Entwicklung und Vertiefung des christlich-jüdischen Gesprächs. Das Christentum ist von seinem Selbstverständnis her wesentlich mit dem Judentum verbunden. Damit dies den Christen deutlicher bewusst wird, hat der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) im Jahr 2000 den 17. Jänner als besonderen Gedenktag im Kirchenjahr eingeführt. Dabei sollen sich die Christen in besonderer Weise ihrer Wurzeln im Judentum und ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusst werden. Es geht nicht darum, über das Judentum zu lernen, sondern vom Judentum und besonders mit Jüdinnen und Juden.
Der linke Antisemitismus zeigte sich 2022 zum Beispiel auf der internationalen Kunstschau Documenta 15 in Kassel, wo Großgemälde antisemitische Motive aufwiesen. Was unterscheidet den sogenannten rechten vom linken Antisemitismus?
Der rechte Antisemitismus wird besonders in unseren Breitengraden wesentlich stärker wahrgenommen und beachtet, während der linke oft vernachlässigt wird. Dabei sind der linke und vielleicht auch noch der muslimisch gefärbte Antisemitismus von mindestens gleicher Intensität und Bedrohung wie der rechte. Sie sind genauso gefährlich. Ich würde nicht sagen, dass sich diese Antisemitismen, was die Gefahr betrifft, merklich voneinander unterscheiden.
Was könnte und sollte Ihrer Ansicht nach getan werden, um das gegenseitige Verständnis zwischen Juden und Christen noch mehr zu vertiefen?
Ich bin kein Freund des institutionalisierten Dialogs. Ich glaube, dass der gelebte Dialog eigentlich das ist, was man anstreben muss und dass besonders die gelebte Vermittlung etwas ist, was von großer Bedeutung ist: das Aufeinander-Zugehen, das Vermitteln des wechselseitigen Alltags, auch des religiösen Alltags. Und ich denke, daran müssen wir arbeiten, an realen Begegnungen, um uns kennenzulernen und uns nicht im Theoretischen zu ergötzen. Es ist immer schwieriger, so glaube ich, einander in dem anzunehmen, was einem nicht gemeinsam ist. Die Anfänge des sogenannten christlich-jüdischen Dialogs lagen darin, sich wechselseitig zu versichern, was man alles gemeinsam hat. Ich glaube, das ist keine Kunst, sich in dem anzunehmen, was man gemeinsam hat. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, den anderen anzunehmen in dem, was und wie er anders ist. Und das sollten wir vermehrt lernen in der Begegnung.
Der gelebte Dialog ist eigentlich das, was man anstreben muss ...
Elie Rosen
Wie sieht dann dieser, wie Sie gesagt haben, gelebte Dialog in Graz und in Baden aus?
Wir sind in Graz sehr stark in der Vermittlung tätig. Das heißt, wir versuchen, ein positives Judentum dem nichtjüdischen Umfeld weiterzugeben, beispielsweise in der Aufklärungsarbeit. Das heißt, wir vermitteln Wissen über jüdische Feste, wir vermitteln Aspekte der jüdischen Kultur, aber wir laden auch zu Feiern und Konzerten ein und wir haben ein offenes Haus, eine offene Synagoge, vor allem in Graz, wo die räumlichen Gegebenheiten das auch erlauben. Auch in Baden haben wir ein interkulturelles Zentrum, das sich im Wesentlichen auch diese Zielsetzungen zur Aufgabe gemacht hat.
Sie haben vorhin Gemeinsames und Trennendes angesprochen Was haben wir gemeinsam, was trennt uns?
Das Gemeinsame sollte in erster Linie die Liebe zu den Menschen sein. Und dazu kommt natürlich die monotheistische Dimension, wenn wir schon auf der religiösen Ebene bleiben wollen.
Ist die christlich-jüdische Begegnung mehr als nur eine Sache der Fachleute, ohne dabei die Basis zu erreichen?
Diese Form der christlich-jüdischen Begegnung, oft nur theoretischer Natur, ist genau jene Form des Dialogs, die ich vorhin als überholt angesprochen habe. Denn dann ist sie nur eine Form der Fachleute und Experten. Wenn man den gelebten christlich-jüdischen Dialog wirklich ernst nehmen und nicht nur exegetisch betreiben will, dann geht es dabei immer um eine Form des Dialogs zwischen den Menschen und nicht nur zwischen verschiedenen Theologen.
Wenn Sie einem Nichtjuden das Judentum in drei Sätzen erklären müssten, wie würden diese Sätze lauten?
Liebe zum Menschen. Liebe zur Schöpfung. Und auch Respekt.
Kommen wir zur Hebräischen Bibel. Welches ist Ihr Lieblingsbuch in der Hebräischen Bibel?
Ich gestehe, ich habe kein Lieblingsbuch. Ich glaube, man kann in der Thora so unzählig viele Stellen finden, aus denen man etwas lernen und aus denen man Weisheiten gewinnen kann, dass man kein eigenes biblisches Lieblingsbuch mehr braucht.
Welche biblische Gestalt ist Ihnen wichtig?
Das ist jetzt eine sehr stark biblisch geprägte Unterhaltung. Für mich ist diese biblische Gestalt vor allem Moses. Er ist eine ganz zentrale Gestalt, denn durch das Wirken des Mose wurde eigentlich die Geburtsstunde des jüdischen Volkes eingeleitet. Insofern ist er für mich eine ganz wichtige biblische Gestalt.