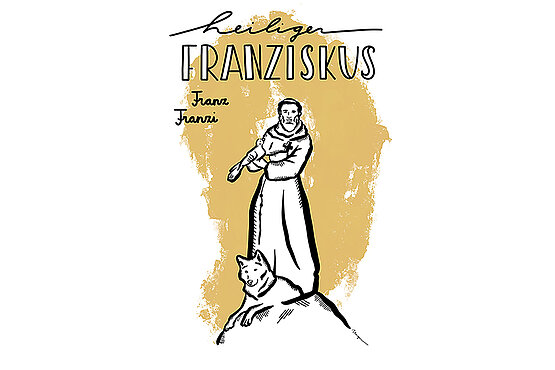Eine Mutter erzählt: Leben mit Autismus und ADHS
Welttag Menschen mit Behinderung
Juni 2004: In der 34. Schwangerschaftswoche, sechs Wochen zu früh, kommt Max auf die Welt. Für seine Eltern Birgit und Michael Kubik ist nicht nur die Geburt anders, als sie es sich erwartet haben. Max ist winzigklein, muss in den Brutkasten. Das bedeutet: kein Kuscheln mit seinen Eltern. Kein entspanntes Gestillt-Werden. Kein rasches Nach-Hause-Getragen-Werden. Das Loch in der Wand des Brutkastens ist fürs Erste die einzige Möglichkeit für seine Eltern, ihm wenigstens ein Minimum an Streicheleinheiten zu geben.
Die Sorgen sind groß und sie bleiben es auch. Mit nur wenigen Tagen bekommt Max eine Magensonde, weil ihn das Trinken zu sehr anstrengt. Knapp zwei Wochen nach der Geburt diagnostizieren die Ärzte bei ihm eine Lungenentzündung. „Ihr Sohn kämpft jetzt schon das zweite Mal um sein Leben“, hören Birgit und Michael Kubik. Und damit nicht genug. Bald stellt man fest, dass der Ductus Arteriosus, ein kleines Gefäß, das beim ungeborenen Baby die Aorta mit der Lungenschlagader verbindet und das sich normalerweise nach der Geburt verschließt, genau das bei Max nicht getan hat. Mit nicht einmal drei Wochen muss Max herznah operiert werden. „Muttersein habe ich mir anders vorgestellt“, konstatiert Birgit Kubik nüchtern in ihrem Buch „In seinem Element“, das im Tyrolia Verlag erschienen ist. Sie erzählt darin in geradezu beeindruckender Ehrlichkeit vom herausfordernden Alltag mit ihrem Sohn Max – vom Kontrollzwang ihres Sohnes, von Spuckattacken, lauten Würgegeräuschen und Ausrastern. Aber sie erzählt auch von Max charmanter, liebenswürdiger Art, mit der er die Menschen für sich gewinnt, und von seiner ungeheuren, ansteckenden Lebensfreude.
Max ist 19 Jahre alt. Bis vor etwa einem halben Jahr hat er bei seiner Familie in Enns gelebt. Im Mai ist er in eine betreute Wohngemeinschaft gezogen. „Betreut“ deshalb, weil er nicht alleine leben könnte. Max hat eine Behinderung – sein Autismus, ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ein Entwicklungsrückstand prägen seinen Alltag.
Ihr Buch ist wie ein Tagebuch verfasst. Haben Sie immer schon Tagebuch über Ihr Leben mit Max geführt?
BIRGIT KUBIK: Begonnen hat es damit, dass ich schon als Max noch wesentlich jünger war, angefangen habe, einmal im Jahr, am Welt-Autismus-Tag im April, in unserer Gemeindezeitung einen Artikel über Max zu schreiben. Das war quasi die Flucht nach vorne, weil Max über alle Maßen offensiv ist, weil er alle Leute anredet und nicht locker lässt. Und ich wollte in der Zeitung, die doch sehr viele lesen, erklären, was mit unserem Sohn los ist, was bei uns im Alltag passiert und warum es passiert. Vor allem aber wollte ich mich auch bei den Leuten aus unserer Stadt dafür bedanken, dass sie Max stets geduldig und freundlich entgegenkommen.
Dann kamen Corona und die vielen Lockdowns und die waren mit unserem kontaktfreudigen Max eine besondere Herausforderung. Eines Abends habe mich hingesetzt und zu schreiben begonnen. Ich war ab da wie in einem Rausch – die Erlebnisse der vergangenen 17 Jahre sprudelten nur so aus mir heraus. Es war für mich richtig befreiend, alles niederzuschreiben. Ich konnte das Erlebte so gut ablegen, besser abhaken.
Was war es, was Ihren Familienalltag besonders geprägt hat?
Dass es bei uns immer laut war. Max hört stets laut Musik. Zudem klatscht er gerne, oft und extrem laut in die Hände. Wenn ihn etwas stresst, beginnt er mit seinen Würgegeräuschen – auch die sind unbeschreiblich laut. Und schließlich stellt er ununterbrochen Fragen – das ist seine Art sich mitzuteilen und zu kommunizieren. Eine Frage folgt auf die nächste. Bei all dem herrscht natürlich nie Ruhe – außer Max schläft oder ist außer Haus.
Was war das Herausforderndste im Alltag?
Dass Max sich nicht allein beschäftigen kann und dass er einen so in Beschlag nimmt mit seinen Fragen. Die eigenen Gedanken haben da überhaupt keine Chance. Kaum schaut man mal vor sich hin, fragt er, was los ist und bombardiert einen mit seinen Fragen. Es reicht nicht, dass man physisch anwesend ist, man muss auch geistig bei ihm sein.
Dazu kommt, dass ihn das „Warten“ sehr stresst. Max kann nicht warten, nicht beim Arzt, nicht bis der Besuch kommt, der angekündigt ist. Nicht darauf, dass man etwas, was er gerade haben möchte, erst suchen muss. Die permanente Anspannung, die wir als Familie hatten, um diesem Warten-Müssen keine Chance zu geben, die sitzt noch immer in jeder Faser meines Körpers, hat sich in jeder Zelle eingebrannt.
Das Schöne an Ihrem Buch ist, dass Sie nicht nur die Herausforderungen sehr detailliert beschreiben, sondern auch, was für ein liebenswerter Mensch Max ist.
Ja, das ist er wirklich und das war mir auch wichtig, dass das klar wird. Er ist charmant, lustig und interessiert an seinen Mitmenschen. Und er merkt sich unheimlich viel, er hat ein phänomenales Gedächtnis. Wenn Sie ihm etwas erzählt haben, fragt er beim nächsten Mal garantiert nach, was daraus geworden ist.
Wie muss man auf Max zugehen, damit er sich wohlfühlt, keinen Stress hat?
Was das betrifft, ist Max unkompliziert. Denn im Vergleich zu anderen Autisten haben wir den großen Vorteil, dass Max den ersten Schritt macht. Er geht auf Menschen zu und nimmt ihnen damit die Hemmschwelle. Und dann geht es nur noch darum, sich auf diese Begegnung einzulassen. Bei Max heißt das dann eben auch, seine Fragen zu beantworten. Das ist das Größte, was die Menschen, denen Max begegnet, machen können: sich Zeit für ihn zu nehmen.
Vor etwa einem halben Jahr ist Max in eine vollbetreute Wohngemeinschaft gezogen. Wie geht es Ihnen allen damit? Wie hat sich Ihr Alltag verändert?
Also zunächst: Max ist wirklich gerne dort – das freut mich, das freut uns natürlich sehr. Und unser Alltag – der verändert sich erst langsam. Ihn nicht mehr daheim zu haben, ist eine Umstellung. Am Anfang war die totale Leere. Aber nun legen wir Schritt für Schritt gewohntes Verhalten ab und sehen auch die Erleichterung, die Max Auszug mit sich bringt – etwa, dass ich nun nicht mehr um 16 Uhr zuhause sein muss, weil Max kommt. Das ist unheimlich befreiend und nach wie vor ein Luxus für uns. Der Tag ist nun so lang.
Wenn Sie an die Zukunft denken: Was erhoffen Sie für Max? Was für sich selbst und für Ihre Familie?
Für uns als Familie wünsche ich mir, dass jeder von uns seinen eigenen Weg findet, weil doch die Situation neu ist; dass sich jeder gut entfalten kann, da man nun nicht mehr ständig auf Max rücksichtnehmen muss. Für Max wünsche ich mir, dass er sich in der Wohngemeinschaft wohl fühlt, dass dort neue Freundschaften entstehen und er Menschen hat, die auf ihn eingehen und seine Fragen beantworten. Und ich meine damit nicht nur die Betreuer, sondern neue Bekanntschaften. Eigentlich ist es gar nicht so viel, wenn ich mir das überlege – aber dann natürlich wieder doch. Aber meine Hoffnung, dass sich alles gut entwickeln wird, ist groß.