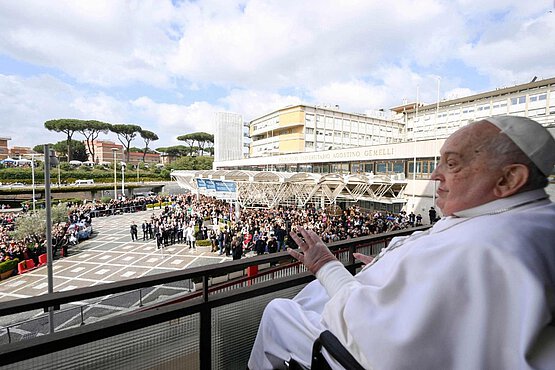Jüngere Menschen sind arbeitsbereit
Zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai
Universitätsprofessor Wolfgang Mazal lehrt Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien. Er leitet auch das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien und ist seit vielen Jahren Gastprofessor an der Kyoto-Universität in Japan. Darüber hinaus ist er seit Jahrzehnten in vielfältigsten ehrenamtlichen Funktionen tätig, unter anderem seit dreieinhalb Jahren als Präsident des Katholischen Laienrats Österreich.
Herr Universitätsprofessor, arbeiten Sie gern?
WOLFGANG MAZAL: Ja!
Warum?
Weil für mich Arbeit ein existenziell wichtiger Lebensvollzug ist. Ich möchte zugleich betonen, dass es verschiedenste Formen von Arbeit gibt. Im 19. Jahrhundert haben wir den Arbeitsbegriff offensichtlich verengt auf Factory and Office (Fabrik und Büro). In der Forschung hingegen unterscheiden wir Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Ehrenamtsarbeit. Ich halte alle drei Formen von Arbeit für sehr wichtig.
Warum wird Arbeit bisweilen verteufelt und Freizeit gern glorifiziert?
Aus meiner Sicht hängt das damit zusammen, dass wir den Arbeitsbegriff losgelöst haben von anderen Formen existentiell wichtiger menschlicher Tätigkeiten. Man glaubt daher, Nachteile und schlechte Konditionen in der Erwerbsarbeit hinnehmen zu müssen, um sie dann mit besseren Konditionen in der Freizeit zu kompensieren. Ich glaube aber, es ist nicht richtig, wenn wir so leben. Wir sollten die Arbeit in jeder Form gut organisieren und wertschätzen, in Form der Erwerbsarbeit, der Familienarbeit und der Ehrenamtsarbeit.
Das Gegenteil von Arbeit ist Arbeitslosigkeit. Im März 2025 waren in Österreich fast 400.000 Personen als arbeitslos gemeldet oder Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Was bedeutet dies für die Betroffenen und für den Staat?
Für die Betroffenen bedeutet das oft einen Wohlstands- und Identitätsverlust. Sofern man diese Zeit nicht anders nutzt. Manche nutzen sie durch nicht legale Erwerbstätigkeit, viele auch durch verstärkte Familienarbeit und Ehrenamtsarbeit. Die gesellschaftliche Organisation sollte daher ausreichend Identitäts- und Erwerbspotenziale durch legale Beschäftigung vermitteln und auch einfordern.
Welchen Wert hat Arbeit sowohl für die einzelne Person als auch für die Gesellschaft?
Für die einzelne Person ist Arbeit wichtig für die Findung der Identität, von zumindest teilweisem Lebenssinn. Arbeit kann das Gefühl und die Überzeugung geben, dass das, was man macht, Sinn macht. Für eine hochkomplexe arbeitsteilige Gesellschaft ist es aber auch wichtig, dass Tätigkeiten einfach verrichtet werden, selbst wenn die Sinnstiftung für den Einzelnen gering ist. Da scheint es jetzt eine Kluft zu geben. Was die Gesellschaft oft braucht, scheint für den Einzelnen keinen Sinn zu machen und keinen Wert zu haben. Ich halte das für eine bedenkliche Entwicklung. Denn der Wert entsteht in Wahrheit durch die Außenwahrnehmung. Etwas, was wertvoll ist, gewinnt seinen Wert dadurch, dass es wertgeschätzt wird. Und ich glaube, auch die angeblich noch so geringsten Tätigkeiten verdienen Wertschätzung. Eine arbeitsteilige Gesellschaft ohne diese Tätigkeiten wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass man neue Jobs schaffen müsse. Und da hat ein Kollege auf Englisch gesagt: „Yes, but real jobs and not cleaning and so.“ Aus meiner Sicht ist das ein fataler Indikator für die Fehlentwicklung der Gesellschaft. Was wäre unsere Gesellschaft ohne Reinigungstätigkeiten? Es bedarf auch hier großer Wertschätzung. Dann können auch diese Menschen sich wertgeschätzt fühlen, was notwendig ist in einer arbeitsteiligen Organisation.
Nun gibt es Jüngere, die sagen: Ich möchte weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. Wie ist das zu bewerten?
Jüngere Menschen sind arbeitsbereit. Sie offerieren dem Arbeitsmarkt 30 bis 35 Stunden. Sie sind bereit, wenn es unbedingt notwendig ist, auch auf 40 Stunden zu gehen. Ich halte das für ein durchaus vernünftiges Vollzeitangebot. Manche Firmen fordern heute aber 50 bis 60 Stunden ein. Das ist ein unvernünftiges Vollzeitangebot und gefährdet andere Arbeitsformen, nämlich die Familien- und die Ehrenamtsarbeit. Jungen Leuten wird oft unterstellt, dass sie nicht leistungsbereit sind. Personalisten sage ich dann: Nennt sie nicht leistungsunwillig, sondern sagt, die sind sozial kompetent. Die wollen nämlich anders leben als die Vorgeneration, wo sie gesehen haben, dass die Beziehungen typischerweise kippen. Wer zu stark im Erwerb steht, wird weniger Zeit für Beziehung, für Familienarbeit und Ehrenamt haben, was gesamtgesellschaftlich ebenfalls sehr wichtig wäre.
Wie steht es um die Familienarbeit – um Pflege zu Hause oder um die Kindererziehung?

Familienarbeit wird eigentlich immer weniger gemacht. Wir wissen von den großen Schwierigkeiten, dass Kinder nicht einmal die berühmte warme Mahlzeit bekommen. Wir wissen von den großen Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Erwerb in der Früh und am Nachmittag und am Abend. Wir wissen, dass das nicht immer kompensiert werden kann durch außerfamiliäre Institutionen, die sich sehr bemühen, aber doch etwas anderes liefern als das, was durch Familienarbeit geleistet werden kann. Wir wissen, dass Familienarbeit in der Pflege zurückgeht. Und wir wissen, dass Familien insgesamt zurückgehen, weil der Kinderwunsch und die tatsächliche Realisierung des Kinderwunsches in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen sind.
Braucht es auch ein Stück weit ein Umdenken bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern?
Was die Lohntangente betrifft, die Sie angesprochen haben, so haben wir tatsächlich ein Problem: Dass Ältere oft sehr teuer sind, verglichen mit Jüngeren. Das ist ein Thema, das allerdings nicht durch den einzelnen Arbeitgeber gelöst werden kann, sondern das ist eine Frage der Lohnpolitik der Sozialpartner. Wir haben in vielen Kollektivverträgen nach wie vor das sogenannte Senioritätsprinzip. Das ist in den letzten Jahren zwar etwas abgemildert worden, aber es ist tief in den Köpfen der Menschen. Und das erklärt, warum Junge dann auch oft ziemlich Unverständnis zeigen gegenüber Älteren, die das Doppelte verdienen. Und die machen dann Druck auf die Älteren, der dann wiederum gesundheitliche Probleme erzeugt. Ich glaube, diese Systeme schaden alten und jungen Arbeitnehmern, schaden auch der längerfristigen, nachhaltigen Beschäftigung der Älteren. Und dies gehört längst überwunden. Hier ist insbesondere die Sozialpartnerschaft gefordert.
Warum werden die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt bisweilen mit Sorgen verbunden? Werden sich durch die Digitalisierung auch die beruflichen Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten grundlegend verändern?
Wir beobachten seit Jahrzehnten einen kontinuierlichen Wandel in den Qualifikationserfordernissen in der Arbeitswelt. Durch Digitalisierung wird das beschleunigt werden. Aber ich denke, der Grundsatz, dass sich die Qualifikationen verändern, das ist weder etwas Neues noch etwas Schlimmes. Was wir uns nur vor Augen halten müssen, ist, dass das rascher geht als in Vorgenerationen. Wir müssen daher das Konzept des „lifelong learning“, des lebenslangen Lernens, ernst nehmen und uns regelmäßig auf die Höhe der Zeit bringen mit unseren Qualifikationen. Ich habe mir vor vielen Jahren schon vorgestellt, dass jeder Erwerbstätige, selbstständig oder unselbstständig, irgendwann mit 30 Jahren vom Arbeitsmarktservice einen Brief bekommt, der besagt: „Überleg’ dir, wo du mit 35 Jahren eine Ausbildung machen willst, die dich dann für die nächsten 15 Jahre fit, job-ready, hält. Und wir werden dir vom Arbeitsmarktservice Unterstützung geben und das auch bezahlen, denn wir haben ein Interesse daran, dass du weiterhin in einer sich wandelnden Erwerbswelt tätig sein kannst.“ Das gehört unterstützt durch die Gesamtgesellschaft, dann könnten wir die Menschen viel länger im Erwerb halten, ohne dass sie ausgebrannt werden. Ich halte das für viel besser als zu sagen: Die Leute haben ihren Beruf und das muss jetzt so bleiben und es darf sich drum herum nicht viel ändern.
Vor 35 Jahren, am 15. Mai 1990, erschien der bislang letzte Sozialhirtenbrief der österreichischen Bischöfe. Ist dieser noch aktuell – es gab damals keine Digitalisierung. Oder braucht es eine Fortschreibung oder überhaupt einen neuen Sozialhirtenbrief?
Tatsächlich sind viele Aussagen aus meiner Sicht nach wie vor relevant, man kann sie verwenden. Eine fortwährende Aktualisierung ist immer sinnvoll. Man sollte sich regelmäßig Texte vornehmen und fragen: Passt das noch auf die heutige Zeit? Ich glaube allerdings, wir sollten gerade in diesen Zeiten und Jahren auf synodalem Weg ein gemeinsames Statement von Bischöfen und Laien zu diesen Fragen unserer Zeit zustande bringen.
Wie kann das konkret aussehen?
Dass man gemeinsam – die Bischofskonferenz und die Laienvertretungen – sich diesen Themen widmet und einen Text schafft, der sich den Themen unserer Zeit stellt und Antworten aus katholischer Sicht formuliert. Wir haben in der Kurie 5 des Laienrats tatsächlich ein sehr großes Papier, das in den letzten Jahren erarbeitet wurde, wo die Laien ihr Statement abgegeben haben zur österreichischen Gesellschaft und zur österreichischen Wirtschaft. Ich halte das für ein sehr gutes Papier, mit dem man weiterarbeiten könnte und mit dem man gemeinsam mit der Bischofskonferenz dazu ein gemeinsames Wort formulieren kann. Solange das aber nicht geschieht, ist es wichtig, dass zumindest im Rahmen des Katholischen Laienrats hier eine entsprechende Festlegung erfolgte.