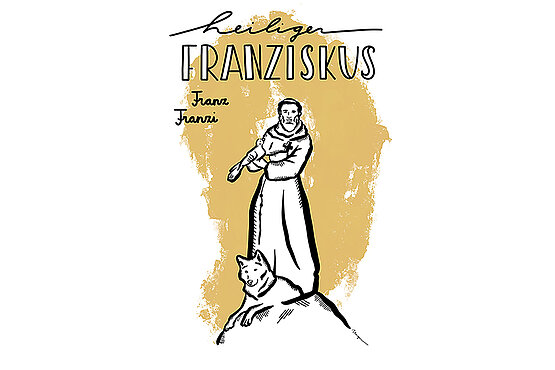Jerusalemkreuz: Vom Pilgern in die Politik
Ideologischer Missbrauch
Das Jerusalemkreuz, ein quadratisches Kreuz umgeben von vier kleinen Kreuzen, ist seit Jahrhunderten ein stark präsentes Symbol in der Heiligen Stadt. Es dient als Zeichen von Katholiken und westlichen Pilgern im Heiligen Land. In jüngster Zeit erfreut es sich auch zunehmender Beliebtheit bei Anhängern einer Ideologie der weißen Vorherrschaft unter der neuen Rechten, die es als Symbol anti-islamischer Kreuzzugsromantik sehen.
Diskussion um Jerusalemkreuz
In diese Diskussion geriet nun das überdimensionale Jerusalemkreuz-Tattoo auf der Brust des designierten US-Verteidigungsministers Pete Hegseth. Kritiker stellten es in die Tradition der Kreuzzüge, woraufhin Hegseth ihnen antichristlichen Fanatismus vorwarf. In der Region sieht man die politische Aufladung des religiösen Symbols mit Sorge.
Geschichte des Jerusalemkreuzes
Das Jerusalemkreuz ist das Emblem der Franziskaner im Heiligen Land und das Wappen des „Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ (Grabesritter). Es findet sich auch im Wappen des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem und als Tattoomotiv bei Pilgern. Hegseth, ein evangelischer Christ, trägt neben dem Jerusalemkreuz weitere religiös inspirierte Motive auf seinem Körper. Der Schriftzug „Deus vult“ (Gott will es) auf seinem Bizeps ist ebenfalls ein Erkennungszeichen und der Wahlspruch des Ritterordens vom Heiligen Grab. Beide Symbole stehen für die Ära der Kreuzzüge, eine militante Epoche in der Geschichte der katholischen Kirche.
Der Historiker Mordechay Lewy, ehemaliger israelischer Botschafter im Vatikan, widerspricht jedoch der populären Vorstellung: Für die gesamte Kreuzzugszeit bis 1291 sei nicht ein einziges Jerusalemkreuz bekannt. Das vom „Königreich Jerusalem“ verwendete Kreuz habe die klassische Form gehabt. Lewy sieht Hegseth als „Opfer“ einer weit verbreiteten Folklore.
Jerusalemkreuz: Symbol für die fünf Wunden Christi
Laut Lewy taucht das Jerusalemkreuz erst Anfang des 14. Jahrhunderts auf und wird zum Markenzeichen der Franziskanerkustodie und der Heiliglandpilger. Seine Bedeutung erhalte es nicht von seiner Form, sondern von der Anzahl der Kreuze, die für die Wunden Christi stehen. Hegseth selbst scheint seine Körperkunst in der Kreuzfahrertradition zu sehen. In seinem 2020 erschienenen Buch „American Crusade“ beschreibt er, wie christliche Ritter vor tausend Jahren unter dem Schlachtruf „Deus vult“ gegen „muslimische Horden“ antraten, um „Europa zu retten“. Er zieht Parallelen zum heutigen „Kampf“ Amerikas gegen Islamisten.
Politische Instrumentalisierung religiöser Symbole
Der Franziskaner Gregor Geiger sieht solche Ideen und die politische Instrumentalisierung religiöser Symbole kritisch. Für die Christen im Heiligen Land könne dies schädlich sein, da die arabische Welt kaum zwischen einheimischen Christen und dem Westen unterscheide. Karl Lengheimer, früherer Statthalter der Grabesritter für Österreich, warnt vor dem ideologischen Missbrauch des „Deus (lo) vult“ durch rechtsstehende Kreise. Er erinnert an die verheerenden Folgen solcher Massenphänomene in der Geschichte.
Orden distanziert sich von kriegerischen Interpretationen
Der Orden der Grabesritter selbst distanziert sich von kriegerischen Interpretationen. Abt Nikodemus Schnabel, selbst Ritter des Ordens, betont den karitativen und unpolitischen Charakter des Laienordens. Die Unterstützung der Christen im Heiligen Land habe nichts mit romantisierenden Kreuzfahrerideen zu tun. Schnabel sieht Pilgertattoos grundsätzlich positiv, solange sie nicht als Ausdruck einer „Kreuzfahrer 2.0“-Mentalität verstanden werden. Sie seien vielmehr Teil einer jahrhundertealten Tradition, mit der Pilger ihre prägende Erfahrung im Heiligen Land verewigen.
Die Debatte um Hegseths Tattoo zeigt die komplexe Bedeutung religiöser Symbole in einer zunehmend polarisierten Welt. Während für einige das Jerusalemkreuz ein Zeichen des Glaubens und der Verbundenheit mit dem Heiligen Land bleibt, sehen andere darin eine problematische Verknüpfung von Religion und Politik. Die Herausforderung besteht darin, die historische und spirituelle Bedeutung solcher Symbole zu bewahren, ohne sie für ideologische Zwecke zu missbrauchen.