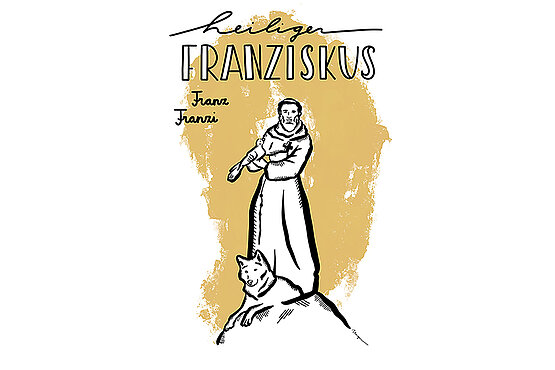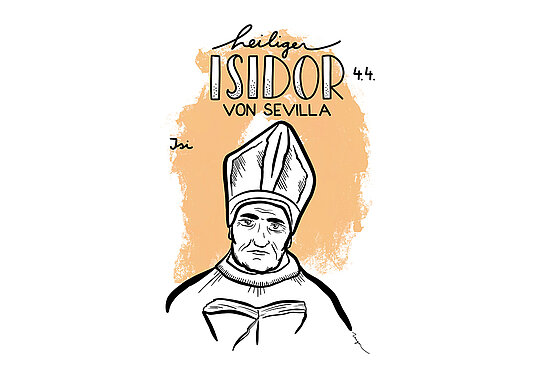Auf der Suche nach dem tieferen Sinn des Lebens
Über Umwege zum PriesterEs weht ein eisiger Winterwind durch die Wiener Innenstadt. Kurzfristig treffen wir die Entscheidung, das Interview mit Pater Markus Inama nicht im Freien vor der Jesuitenkirche zu führen, sondern uns in die warmen Räumlichkeiten der Jesuitenkommunität gleich daneben zu begeben. Zu Beginn erzählt Markus Inama, wie er nach seiner Priesterweihe 1995 mit der Jugendpastoral in Wien begonnen hat. „Ich hatte dafür keine spezielle Ausbildung. Wahrscheinlich war meine eigene Jugend die beste Voraussetzung, um Jugendliche durch diese Lebensphase zu begleiten, Verständnis aufzubringen, aber auch hier und da Grenzen einzufordern.“ Es war nicht seine erste Station in der Bundeshauptstadt. Inama war schon zehn Jahre davor in der Sozialarbeit tätig und Leiter eines Obdachlosenheims in Wien.
Wie haben Sie den Weg in den Orden gefunden?
Für mich war die Zeit in den Obdachlosenheimen, die Pater Georg Sporschill gegründet hatte, ein Aha-Erlebnis, weil ich Ordensleben als etwas erfahren habe, bei dem ich mitten in der Welt an einem Brennpunkt bin und aus dem Glauben heraus versuche, Menschen zu helfen. Das hat mich einfach fasziniert: Den Glauben zu verkünden schließt auch den Einsatz für Gerechtigkeit ein. So habe ich gewagt, darüber nachzudenken, in den Jesuitenorden einzutreten. Bei den Aufnahmegesprächen hatte ich das Gefühl, dass ich kritisch hinterfragt werde. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich gesagt habe: „Ich möchte Sozialarbeit machen, um mich für die sozial Schwachen einzusetzen.“ Und mein Gegenüber, ein Mitbruder, hat geantwortet: „Aber das kannst du auch als Nicht-Jesuit tun.“ Ich habe folgendermaßen argumentiert und damit schlussendlich Gehör gefunden: „In dieser Begegnung mit obdachlosen Menschen spüre ich auch meine eigene spirituelle Obdachlosigkeit. Und ich bin auf der Suche nach einer spirituellen Heimat.“ Die Suche hat mit dem Eintritt ins Noviziat 1987 erst richtig begonnen. Es war kein leichter Weg. Immer wieder gab es neue Herausforderungen. Langsam bin ich in den Orden hineingewachsen.
Ich bin auf der Suche nach einer spirituellen Heimat.
Markus Inama
Was beschreibt denn Ihren Orden?
Ich würde da gerne eine Gegenfrage stellen: Welche Vorstellung haben andere Menschen von den Jesuiten? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedlichste Antworten. Das ist eben auch typisch für uns Jesuiten, dass wir in unterschiedlichsten Bereichen tätig sind – im Bildungsbereich, aber auch in der normalen Seelsorge.
Jesuiten engagieren sich aber auch in der Sozialarbeit.
Schon unser Ordensgründer Ignatius von Loyola hat soziale Projekte ins Leben gerufen, Häuser für Witwen und für Kinder eingerichtet. Das ist bei ihm immer ganz normal mitgelaufen. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde dieser Einsatz für Gerechtigkeit aus einer Spiritualität heraus im Jesuitenorden noch viel stärker betont. Ignatius war es wichtig, einerseits eine Gemeinschaft zu bilden, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Aber diese Gemeinschaft ist andererseits so geprägt, dass es genügend Freiheiten gibt, um für konkrete Nöte der Menschen da zu sein. Bei uns spielen die Exerzitien, die geistlichen Übungen, eine große Rolle. Jeder Jesuit muss zweimal im Leben die 30-tägigen Exerzitien machen. Später hat es sich so etabliert, dass jeder Jesuit einmal im Jahr eine Schweigewoche macht, in der wir in die Tiefe gehen, wo wir all das, was wir erlebt haben, mit hineinnehmen. Wir versuchen in dieser Zeit von Neuem, den Ruf in der Beziehung zu Jesus zu hören und den Ruf wahrzunehmen für das, was heute notwendig ist.
Jetzt stehen wir vor der Fastenzeit. Viele Menschen suchen besonders in dieser Zeit des Jahres Ruhe und Einkehr. Sind die Ignatianischen Exerzitien etwas für diese Menschen oder ist das ein zu schwerer Ansatz?
Zwei Tage der Stille sind ein guter Einstieg. Es gibt auch Angebote für junge Menschen, die nicht so herausfordernd sind, was die Stille betrifft. Wobei die Stille schon ein wichtiges Element ist und einmal zwei, drei Tage auf das Handy zu verzichten, ist heutzutage wirklich eine Herausforderung. Aber das ist etwas, was ich jedem Menschen empfehlen möchte: solche stillen Zeiten einzubauen und wirklich einmal in die Tiefe zu kommen und Gefühle zuzulassen, die vielleicht sonst im Alltag eher untergehen.
Pater Markus Inama
Markus Inama wurde 1962 in Vorarlberg geboren. Er war als Leiter eines Obdachlosenheims in Wien tätig, bevor er 1987 in den Jesuitenorden eintrat. Von 1995 bis 2008 arbeitete er im Bereich der offenen Jugendarbeit in Wien und Innsbruck. Danach engagierte er sich in Sofia im Rahmen der CONCORDIA-Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße und in Armenvierteln lebten. Seit 2009 ist er Mitglied des Vorstands von CONCORDIA-Sozialprojekte. Von 2012 bis 2018 war er Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck und seither ist er Superior der Jesuiten in Wien.
Es gibt einen Jesuiten, der natürlich jetzt für den Orden seit einem Jahrzehnt nicht greifbar ist, aber der wohl der bekannteste ist: Papst Franziskus. Wie erleben Sie sein Pontifikat?
Ich hatte drei Begegnungen mit ihm. In Bulgarien habe ich Papst Franziskus 2019 vor der Alexander-Newski-Kathedrale in Sofia getroffen. Zwei oder drei Kinder aus dem CONCORDIA-Projekt waren mit dabei. Damals hatte Franziskus ein wenig Zeit und wir konnten kurz miteinander reden. Ich habe einfach gemerkt, was er an Aufmerksamkeit und Herzlichkeit einbringt. Das war für mich sehr wohltuend, wertschätzend, berührend. Ich merke immer wieder, dass mir dieser Papst näher kommt als seine Vorgänger. Ich habe den Eindruck, Papst Franziskus ist im Herzen Jesuit geblieben. Dadurch fühle ich mich innerlich mit ihm verbunden.
Papst Franziskus ist im Herzen Jesuit geblieben.
Markus Inama
Bulgarien war auch ein wesentlicher Ort, der Sie im Leben sehr geprägt hat.
Ich war als Jesuit zwölf Jahre in der Jugendarbeit tätig und danach kam für mich der Wunsch, wieder mehr in die Sozialarbeit zurückzukehren. Als zwei Jugendliche aus unserem Jugendzentrum in Innsbruck in Rumänien im Projekt von Pater Sporschill ein Praktikum gemacht haben, bin ich mit CONCORDIA in Berührung gekommen. Dann hat es sich gut getroffen, als Pater Sporschill in Bulgarien ein Haus angeboten worden ist, um dort ein Sozialzentrum für Kinder und Jugendliche aufzubauen. Damit war ich ab 2008 bis 2012 beschäftigt. Verglichen mit der Arbeit für obdachlose Menschen in Wien war es ein stärkeres Ausgesetztsein in einem Land, in dem ich fremd war und die Sprache anfangs gar nicht beherrschte. Ich habe gespürt, dass die Mehrheitsbevölkerung dieses Engagement für die Menschen, die illegal im Armenviertel leben, nur teilweise nachvollziehen konnte.
Mittlerweile tragen Sie noch größere Verantwortung für CONCORDIA als Vorstandsmitglied. Vor einem Jahr wurde der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. CONCORDIA leistet besonders in der Republik Moldau große Hilfe.
Wir sind die größte Nichtregierungsorganisation in der Republik Moldau, denn wir haben dort 50 Standorte. Wirklich tolle Menschen, vor allem Frauen, leiten die Sozialzentren und Suppenküchen. Sie sind bereits am 25. Februar 2022 an die Grenze zum Nachbarland gegangen und haben vorwiegend Frauen und Kindern geholfen. Für uns hat sich durch den Krieg sehr viel verändert. Parallel zu unserer Aufgabe für Kinder und Jugendliche in Moldawien haben wir sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns aufgenommen, zu Familien weitervermittelt und auch psychologische Hilfe geleistet. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, die vor allem unsere Kolleginnen vor Ort tragen.